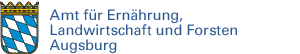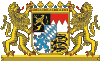Schwaben und Oberbayern-West
Aktuelle Pflanzenbau- und Pflanzenschutzhinweise (Stand: 17. November 2025)
Bodenuntersuchungen nach Standardbodenuntersuchung
Für neu zugepachtete bzw. gekaufte Flächen ist zu beachten, dass eine aktuelle Bodenuntersuchung vorliegen muss. Diese darf ebenfalls wie schon erwähnt, nicht älter als 6 Jahre sein. Um dies zu gewährleisten, müssen gleich bei Zupacht bzw. Erwerb die Proben gezogen werden. Alternativ ist es auch möglich, die Bodenuntersuchung vom Vorbewirtschafter zu übernehmen.
Für die Beprobung bietet sich der Zeitraum Spätherbst bis zum zeitigen Frühjahr an. Die Probenahme ist grundsätzlich nach der Ernte, aber vor der nachfolgenden Düngung der Folgefrucht durchzuführen. Der Boden soll einen Feuchtezustand aufweisen, der eine Bodenbearbeitung erlauben würde. Er soll nicht schmieren, aber auch nicht zu trocken sein. Für die Mischprobe sind mindestens 15 Einstiche zu tätigen, die gleichmäßig und repräsentativ über die zu beprobende Fläche verteilt sind. Einstiche nicht parallel zur Bearbeitungsrichtung, nicht im Vorgewende und nicht am Feldrand. Die Einstichtiefe beträgt bei Ackerland 15 – 20 cm, bei Grünland sind 10 cm empfohlen.
Nähere Informationen zum Ablauf und Anmeldung zur Probenahme beim ER-Südbayern ![]()
Herbizideinsatz im Herbst in Winterweizen, Wintertriticale, Winterroggen und Dinkel
Bei Winterweizen auf Flächen mit einem hohen Ungrasdruck können Herbstbehandlungen ein Teil einer erfolgreichen Bekämpfungsstrategie sein und die hoch resistenzgefährdeten blattaktiven Präparate im Frühjahr entlasten. Der Wirkstoff Flufenacet wurde auf EU-Ebene nicht mehr verlängert, dennoch können flufenacethaltige Präparate in diesem und voraussichtlich auch nächsten Herbst (Aufbrauchsfrist zwischen 05.12.2026 und 10.12.2026 je nach Präparat) sofern im Handel verfügbar eingesetzt werden. Flufenacet ist als Basiswirkstoff vor allem bei der Ackerfuchsschwanzbekämpfung ein wichtiger Baustein und wird auch für diese Saison empfohlen. Für den frühen Einsatz im Herbst kommen in erster Linie flufenacet-, prosulfocarb und pendimethalinhaltige Mittel im Sinne der Resistenzvermeidung gegen Ackerfuchsschwanz in Frage. Bei Besatz mit Windhalm auf nicht wassersensiblen Standorten sind zusätzlich auch chlortoluronhaltige Mittel möglich, beachten Sie die die CTU-Verträglichkeit der Sorte. Nach unseren Erfahrungen können oftmals im Herbst nur Teilwirkungen erzielt werden, die aber vor allem bei starkem Ungrasdruck die Frühjahrsbehandlung deutlich vereinfachen können. Bei der Anwendung von blattaktiven Mitteln (z.B. Traxos) muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Ungräser aufgelaufen sind und 1-2 Blätter gebildet haben. Der Einsatz von Axial 50 ist, wenn Wintergerste in der Fruchtfolge steht, auch auf diese zu beschränken.
Der Herbizideinsatz im Herbst in Dinkel ist ebenfalls möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass der Einsatz von Boxer bzw. Filon nur im Vorauflauf zugelassen ist. Betriebe ohne Wintergerste in der Fruchtfolge, können gegen Ackerfuchsschwanz beispielsweise auch Axial 50 in Dinkel einsetzen.
Folgende Herbizidempfehlungen sind für Weizen, Roggen u. Triticale für den Herbst 2025 möglich:
Windhalmstandorte (im frühen Nachauflauf)
- flufenacethaltiges Breitbandmittel*
- 3,0 Jura Max oder Boxer Evo
- 0,35 Mateno Duo + 0,5 Beflex
- 3,0 Boxer + 0,06 Alliance (Boxer nicht in Triticale)**
- 2,5 Boxer + 0,3 Beflex (Boxer nicht in Triticale)**
- 1,5 Carmina 640 + 0,06 Alliance
- 1,5 Carmina 640 + 0,3 Beflex
- 2,0 Trinity
Ackerfuchsschwanzstandorte (im frühen Nachauflauf)
- flufenacethaltiges Breitbandmittel*
- 2,5 Stomp Aqua + 2,5 Boxer
- 2,5 Stomp Aqua + 3,0 Lentipur
- 2,0 Boxer + 0,5 Herold SC
- 2,0 Trinitiy + 2,5 Boxer
- 3,0 Jura Max + 0,5 Beflex
Bei Bedarf Folgebehandlung im Frühjahr (extremer Ackerfuchsschwanzbesatz)
- 0,2 - 0,33 Atlantis Flex + FHS
* soweit verfügbar und anwendbar
** alternativ können andere Prosulfocarb-Produkte (Fantasia Gold, Roxy EC einesetzt werden)
Verzwergungsviren in Wintergersten- und Winterweizen
Vor allem früh gesäte und jetzt bereits im 1-2 Blattstadium befindliche Wintergersten sind gefährdet. Bei Wintergersten und Winterweizen, die erst jetzt auflaufen ist die Gefahr deutlich geringer bis vernachlässigbar (je nach Witterung und Blattlausflug). Verzwergungsviren werden durch Läuse (Gerstengelbverzwergungsvirus - BYDV) bzw. durch eine Zwergzikadenart (Weizenverzwergungvirus - WDV) übertragen. Unabhängig von ihrem Namen können die Viren auf Gerste und Weizen, aber auch auf andere Getreidearten übertragen werden.
Die durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass dieses Jahr ein durchschnittlicher bis etwas höherer Befall je nach Region vorzufinden ist. Auf den untersuchten Standorten wurde an 30 % der Pflanzen Befall mit BYDV, WDV oder Mischinfektionen nachgewiesen. Die Untersuchungsergebnisse geben allerdings nur die Infektionswahrscheinlichkeit für die Überträger wieder, entscheidend ist das Auftreten von Läusen bzw. Zikaden in den Wintergerstenbeständen. Eine Kontrolle in der auflaufenden Gerste ist daher schlagspezifisch unerlässlich. Aufgrund der vergangenen oft nassen Witterung und der Erfahrungen der letzten Jahre wurden bisher im Vergleich viele Gersten etwas später ausgesät. Da für ein Läuseauftreten warme und trockene Herbstwitterung entscheidend ist, werden erst nachfolgend auflaufende Bestände aller Wahrscheinlichkeit nach weniger betroffen sein. Bestände die sich jetzt im 1-2 Blattstadium befinden, sollten aber kontrolliert werden. Eine chemische Bekämpfung ist sinnvoll, wenn etwa 10-15 % der Pflanzen Läuse aufweisen. Vermeiden Sie aber aus Resistenzgründen auf jeden Fall unnötige Behandlungen ohne Kontrolle bzw. unterhalb der Schadschwelle. Anzuwenden sind Pyrethroide wie zum Beispiel Karate Zeon, Sumicidin Alpha EC, Kaiso Sorbie sowie weitere zugelassene Präparate. In Wintergerste ist zudem auch Teppeki (Flonicamid) gegen Blattläuse als Virusüberträger anwendbar.
Schilfglasflügelzikade – Bekämpfung der Nymphen steht jetzt im Vordergrund
Beachten Sie aber dennoch auch den vorbeugenden Erosionsschutz und Schutz vor Nitrateinträgen auf kritischen Flächen. In roten, nitratbelasteten Gebieten ist nach Düngeverordnung bei Ernte vor dem 01.10. und N-Düngung im Folgejahr der Anbau einer Zwischenfrucht notwendig. Nach bisherigen Erkenntnissen scheint hier v.a. Ölrettich die Überlebenschancen der Nymphen am besten zu reduzieren. Eine vor der Saat durchgeführte intensive Bodenbearbeitung hilft auch hier den Nymphenbesatz deutlich zu reduzieren. Verzichten Sie vor allem auf Winterweizen als Nachfrucht. Alle bisher durchgeführten Versuche haben gezeigt, dass vor allem Winterweizen nach Rüben und Kartoffeln die Ausflugszahlen der Zikaden im Folgejahr deutlich erhöht. Als gute Nachbaumöglichkeiten werden alle späten Sommerungen betrachtet, insbesondere Mais, Soja oder möglichst spät angebautes Sommergetreide.
Widerruf der Zulassung von Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Flufenacet
| Zulassungsnummer | Handelsbezeichnung | Widerruf zum | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
|---|---|---|---|---|
| 005878-00 | Herold SC | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 005908-00 | Cadou SC | 05.06.2025 | 05.12.2025 | 05.12.2026 |
| 005908-60 | BAKATA | 05.06.2025 | 05.12.2025 | 05.12.2026 |
| 007149-00 | Aspect | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 008362-00 | CARPATUS SC | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 008362-60 | NACETO | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 008362-61 | Broadcast | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 008392-00 | Quirinus | 09.06.2025 | 09.12.2025 | 09.12.2026 |
| 008395-00 | Pontos | 09.06.2025 | 09.12.2025 | 09.12.2026 |
| 008400-00 | FENCE | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008400-60 | DIPLOMAT | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008400-61 | PALISADE | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008400-62 | FRANZI | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008400-63 | STEEPLE | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008400-64 | GENOLANE Defense 12 | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008548-00 | Mertil | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008548-60 | Reliance | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 008654-00 | SUNFIRE | 08.06.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2026 |
| 008942-00 | Bandur Forte | 08.06.2025 | 08.12.2025 | 08.12.2026 |
| 00A060-00 | ACL+DFF+FFA SC 570 | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 00A139-00 | Vulcanus | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 00A139-60 | Rodrigo | 07.06.2025 | 07.12.2025 | 07.12.2026 |
| 00A448-00 | Chrome | 10.12.2025 | 10.06.2026 | 10.12.2026 |
| 00A963-00 | Vulcanus Top | 30.11.2025 | 30.05.2026 | 10.12.2026 |
| 024834-00 | Malibu | 09.06.2025 | 09.12.2025 | 09.12.2026 |
Die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen ergeben sich aus der Durchführungsverordnung (EU) 2025/910 und dem Pflanzenschutzgesetz. Die Widerrufe gelten mit denselben Fristen auch für zugehörige Pflanzenschutzmittel des Parallelhandels. Nach dem 10. Dezember 2026 sind eventuelle Reste der Pflanzenschutz-mittel entsorgungspflichtig.
Die Zulassungen aller weiteren Flufenacet-haltigen Pflanzenschutzmittel werden zeitnah – spätestens jedoch zum 10. Dezember 2025 – widerrufen. Über die genauen Widerrufsdaten sowie etwaige Abverkaufs- und Aufbrauchfristen informiert das BVL in einer separaten Fachmeldung.
WdüngV-Meldungen und -Mitteilungen zur LfL nur noch per Online-Formular!
Empfänger-Meldung nach § 4 WDüngV über Abnahme von Wirtschaftsdünger - Formularserver Bayern ![]()
Glyphosat - allgemeine Infos und Zulassungsstand
Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft
Fortbildungen nach Pflanzenschutz – Sachkunde – Verordnung
Für altsachkundige Personen begann der erste Fortbildungszeitraum am 1. Januar 2013.
- 1. Fortbildungszeitraum: 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015
- 2. Fortbildungszeitraum: 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018
- 3. Fortbildungszeitraum: 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021
- usw.
Beispiel: Ausstellungsdatum und "Beginn erster Fortbildungszeitraum": 11. März 2015
- 1. Fortbildungszeitraum: 11. März 2015 bis 10. März 2018
- 2. Fortbildungszeitraum: 11. März 2018 bis 10. März 2021
- 3. Fortbildungszeitraum: 11. März 2022 bis 10. März 2024
- usw.
Fortbildungstermine zur Sachkunde im Pflanzenschutz
Dokumentation der Pflanzenschutzmaßnahmen
Aufzuzeichnen ist:
- der Tag der Anwendung
- die behandelte Kultur
- die Fläche, auf der der Pflanzenschutzmitteleinsatz erfolgt ist
- das eingesetzte Mittel (genaue Bezeichnung – bei Packs die Namen der einzelnen Mittel)
- die Aufwandmenge je ha und
- der Anwender des Pflanzenschutzmittels mit seinem Vor- und Zunamen.
Die Landesanstalt für Landwirtschaft bietet unter folgender Internetseite eine vorgefertigte Tabelle für die korrekte Dokumentation der Pflanzenschutzanwendungen. Unter folgender Internetseite können Sie die Dokumentationsvorlage auf Ihren PC laden bzw. ausdrucken:
Lesen Sie hierzu auch
Verbundberatung
Weitere schriftliche aktuelle Hinweise über den Partner in der Verbundberatung - Pflanzenbau Mehr